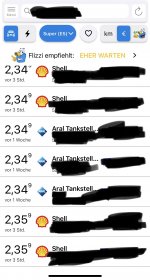Wärmepumpen bleiben unter den Absatzzielen, die Beliebtheit von E-Autos liegt auf dem Elf-Jahres-Tief. Es ist das Resultat einer Politik, die den Markt mit Steuerung, Vorgaben und Subventionen in die „richtige“ Richtung lenken will, am Ende aber bei der Planungssicherheit versagt.
Montag war kein guter Tag für die Energiewende in Deutschland. Praktisch zeitgleich sendeten zwei Branchen, die für die politisch gewollte Transformation weg von den fossilen Energien auf Verbraucherseite fundamental sind, ernüchternde Stimmungsbilder. Zum einen die Wärmepumpenindustrie, zum anderen der Elektrofahrzeug-Sektor. Sie besagen: Die Wärmewende stockt. Und die Verkehrswende auch.
Da klagte zunächst der Bundesverband Wärmepumpe über die Zurückhaltung der Immobilieneigentümer beim Heizungstausch. 500.000 Geräte pro Jahr bis 2030 hatte Wirtschaftsminister Habeck auf einem Wärmepumpengipfel im Vorjahr vollmundig für „machbar“ erklärt. Im Vorjahr waren es immerhin noch 356.000.
Doch für dieses Jahr sieht es finster aus. Am Ende könnten es unter 200.000 sein, schätzt der Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Die Flaute überträgt sich bereits direkt in die Wirtschaft: Der Hersteller Stiebel Eltron meldete
Kurzarbeit an.
Den Hauptgrund für die Zögerlichkeit der Kunden macht Wärmepumpen-Verbandschef Sabel an der Sorge der Verbraucher fest, nach dem Einbau einer neuen teuren Heizung keine Planungssicherheit zu haben. Denn zeitgleich mit dem Heizungsgesetz trat auch das Wärmeplanungsgesetz in Kraft. Das verpflichtet Kommunen zur Prüfung, ob sie den Bürgern in absehbarer Zeit Nah- oder Fernwärme über ein entsprechendes Netz zur Verfügung stellen können.
Und da sich solche Netze nur wirtschaftlich betreiben lassen, wenn es möglichst viele zahlende Abnehmer gibt – siehe den Fall
Wenzenbach, wo jetzt Haushalte seit Monaten im Kalten sitzen –, geistert nun die Sorge vor einem Anschlusszwang durchs Land. Wenn der kommt, so die Logik dahinter, wären alle Investitionen in eine neue Heizung vergebens. Also macht man lieber gar nichts oder nimmt noch mal eine günstigere Gasheizung.
Das Gebäude-Energie-Gesetz mit seinen Komplikationen, und damit zur zweiten schlechten Nachricht des Montags, hat aber interessanterweise Einfluss weit übers Heizen von Haus oder Wohnung hinaus. Renate Köcher, Chefin des renommierten Instituts für Demoskopie in Allensbach (IfD), führt die umstrittene Regelung als Mitgrund dafür an, dass bei den Menschen auch die Skepsis gegenüber dem Elektroauto gewachsen sei.
Gemeinsam mit dem Schock über den unvermittelten Stopp der Förderung, vom Wirtschaftsminister an einem Freitagabend im Dezember für den darauffolgenden Sonntag verkündet, habe das den Bürgern klargemacht, dass politische Vorgaben ihre Handlungsspielräume verringern könnten und so etwas unter Umständen sehr überraschend kommen könne.
Das Resultat dieser Gemengelage: Nur noch 17 Prozent können sich vorstellen, in den kommenden Jahren als nächsten Wagen ein Elektroauto anzuschaffen – ein Wert, so tief wie nie seit 2011.
Flaute bei Wärmepumpen, Flaute bei Elektroautos. Alles nur Zufall? Nein. Es gibt eine Klammer, die die beiden Nachrichten miteinander verbindet. Man muss nicht so weit gehen wie die „Wirtschaftswoche“, die Robert Habeck zum „
König Planwirtschaft“ erklärte. Doch die niederschmetternden Meldungen zur Energiewende belegen, was dabei herauskommt, wenn Politik versucht, Märkte in die „richtige“ Richtung zu lenken, und mit Steuerung, Vorgaben und Subventionen eine von ihr um jeden Preis gewollte Transformation herbeizuregieren – und dann nicht einmal dafür zu sorgen, dass Menschen
sich auf funktionierende Rahmenbedingungen verlassen können.
Beispiel Heizungsgesetz: Die Idee, Deutschland zum Wärmepumpenland zu machen, findet sich bereits in einem Papier, das der inzwischen geschasste Staatssekretär
Patrick Graichen 2017 für seinen damaligen Arbeitgeber „Agora Energiewende“ verfasst hat. Weite Teile davon landeten im Koalitionsvertrag.
Doch die Idee, das Wärmeplanungsgesetz, das den gewünschten Hochlauf der Wärmepumpen nun torpediert, mit dem Heizungsgesetz zu verzahnen, kam der Regierung erst im Juni vergangenen Jahres – und auch erst, nachdem die FDP das Verfahren blockiert und das Gesetz „zurück in die Montagehalle“ beordert hatte. Diese planerische Fehlleistung steht stellvertretend für den gesamten Gesetzgebungsprozess, der seinen Keim in Graichens dirigistischem „Agora“-Konzept hatte.
Und die E-Autos? Der vermeintliche Absatz-Boom, so zeigt sich jetzt, war wesentlich getrieben von den üppigen Subventionen, die sich überwiegend wohlhabende Käufer von den Steuerzahlern sponsern ließen. Besonders schlimm für die, die sich die Autos nicht leisten konnten, besser Betuchten aber gern die Prämie finanzieren durften: Über Jahre kassierten gewiefte Käufer den Umweltbonus und verkauften das geförderte Fahrzeug schnell weiter – in Märkte hinein, auf denen die Autos teurer waren, auch weil es nur eine geringere oder gar keine Förderung gab.
Mit ihrem Wegfall endete zwar zumindest diese Masche. Doch beim Kunden rückt damit auch wieder die Abwägung in den Fokus, welche Antriebsart ausgereifter und zuverlässiger ist, ob ein voller Tank weiter trägt als ein voller Akku und welches Auto sich besser wieder verkaufen lässt. Und welche Technologie da aktuell vorn liegt, ist so klar wie lange nicht.
Doch es sind nicht allein Planungsfehler und die bittere Erkenntnis, dass auch noch so viel Geld nicht ausreicht, um einen Markt nach den ideologiegetriebenen Visionen der Politik zu designen. Die Bürger hinterfragen offenbar auch zunehmend das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag der Maßnahmen, die die Politik ihnen für ihr sauer Erspartes schmackhaft machen will: So ist laut IfD-Chefin Köcher das Zutrauen, dass Maßnahmen im Verkehrssektor viel für das globale Klima bewirken, gesunken.
Kaum anders dürfte es sich grundsätzlich bei der Wärmewende verhalten: Die laut Wirtschaftsministerium 33 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid, die das GEG bis 2030 einsparen soll, emittiert China an einem Tag. Dafür müssen deutsche Eigentümer dank des Gesetzes milliardenschwere Buchverluste ihrer Immobilien hinnehmen und Hunderte weitere Milliarden in sie investieren. Die Kosten für die gesamte Energiewende werden sich laut dem Fortschrittsmonitor Energiewende auf 1,2 Billionen Euro belaufen. Eine Menge Geld dafür, dass Wind und Sonne angeblich keine Rechnung schicken.
Ausland folgt Deutschland nicht bei der Energiewende
Besonders bitter: Ideologiefreier, pragmatischer Klimaschutz wäre mit deutlich niedrigeren CO₂-Vermeidungskosten möglich. Immer mehr Menschen im Land wird zudem klar, dass das zentrale Argument, mit dem die Politik sie über Jahre bei Laune zu halten versuchte, in Echtzeit zerbröselt: Dass Deutschland die Energiewende als Vorreiter so klug gestalten werde, dass dem Land die ganze Welt folgen – und ihm so zu einem neuen Wirtschaftswunder verhelfen werde.
Es mehren sich aber zusätzlich auch die Zweifel an der grundsätzlichen Durchdachtheit von Wärme- und Verkehrswende. Am Versprechen günstiger Strompreise und sauberen Stroms, am Vorhandensein eines tragfähigen Konzepts – am Fundament für eine Nutzung von Wärmepumpe und Elektroauto, bei dem die Bürger nicht für viel Geld Rückschritte bei Praktikabilität und Komfort serviert bekommen.
Zu Tausenden machen die Bürger bereits die Erfahrung, dass ihre Stromnetze nicht auf den schnellen Hochlauf der schönen neuen Elektrowelt ausgelegt sind und sie Wärmepumpe und Wallbox gar nicht bei sich einbauen können. Netzbetreiber dürfen den Strombezug der Geräte bei Bedarf zeitweise einschränken. Und zuletzt hat die Nachricht aus dem brandenburgischen Oranienburg, der zufolge die stark wachsende Stadt keine neuen Stromanschlüsse mehr bereitstellen könne, ein Schlaglicht auf die hohen Anforderungen an den Netzausbau in Zeiten dezentraler Stromversorgung geworfen.
Jahrzehntelang verzieh das System Unzulänglichkeiten bei Planung und Umsetzung. Plötzlich aber zeigt sich: Es wird künftig bundesweit Fachleute brauchen, die ganz genau wissen, was sie tun, damit sich Oranienburg nicht anderswo wiederholt. Auch wenn die Stadt inzwischen
Entwarnung gegeben hat: Der Schaden ist da, das Misstrauen bleibt.
50 Prozent der Wirtschaft sind Psychologie – das gilt auch für die politisch gewollte elektrische Zukunft, mit der die Bundesregierung zulasten der Bürger nichts Geringeres will, als das Weltklima zu retten. Die jüngsten Zahlen aus den genannten Branchen zeigen, dass die Regierung bereits in besorgniserregendem Maß Vertrauen und Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Dass es ihr gelingen könnte, die Menschen im Land, wie es Politiker so gern sagen, bei der Energiewende „mitzunehmen“ – danach sieht es im Moment wahrlich nicht aus.
Mehr hier:
Wärmepumpen bleiben unter den Absatzzielen, die Beliebtheit von E-Autos liegt auf dem Elf-Jahres-Tief. Es ist das Resultat einer Politik, die den Markt mit Steuerung, Vorgaben und Subventionen in die „richtige“ Richtung lenken will, am Ende aber bei der Planungssicherheit versagt.

www.welt.de



 Bei den gestrigen 14kWh Durchschnittsverbrauch inkl. Etappen mit 100km/h und überspitzt 10% Ladeverluste kann da jedenfalls kein Verbrenner mithalten...
Bei den gestrigen 14kWh Durchschnittsverbrauch inkl. Etappen mit 100km/h und überspitzt 10% Ladeverluste kann da jedenfalls kein Verbrenner mithalten...