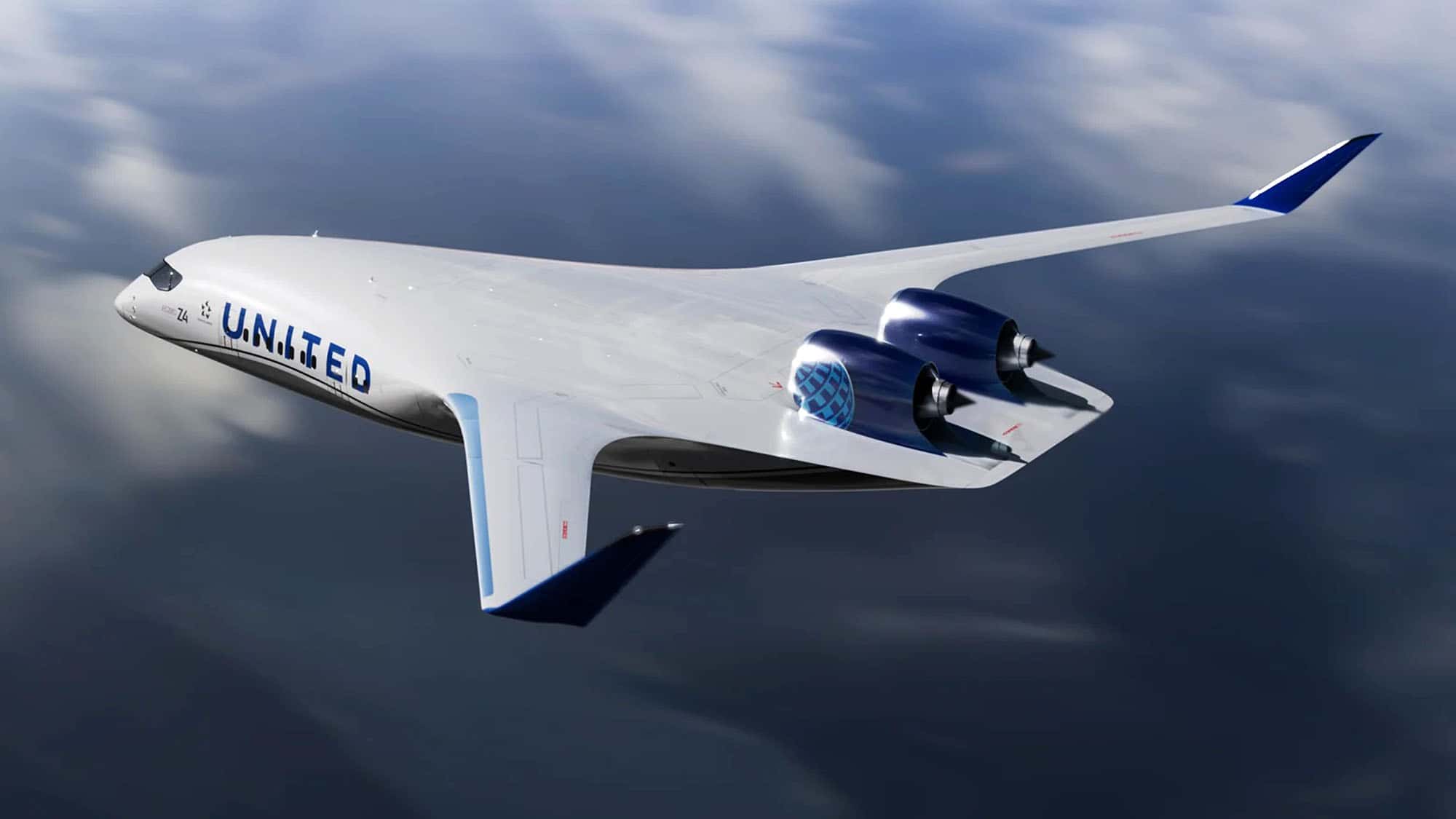Also ich verstehe unter Komplexität wenn die Konstruktion komplizierter geworden ist, also mehr Teile, mehr Systeme, mehr Sensoren, mehr Regelung.... Sowas wie verstellbare Statorschaufeln (aus den späten 50ern), aktive Spaltkontrolle (aus den 70ern) oder Einkristallschaufeln (aus den 80ern).
Und da ist in den letzten 20 Jahren wenig passiert. Bestehende Technologien wurden verfeinert, bestehende Reserven wurden erkannt und ausgenutzt, neue Rechenverfahren haben bessere Geometrien erlaubt. Wobei bei letzterem (transsonische 3D Aerodynamik) vor 35 Jahren vor allem die Russen die treibende Kraft waren.
So Dinge wie Blisks (aus enem Stück gefräste Naben mit Blättern) würde ich eher als reduzierte Komplexität ansehen. Das kann man gerne anders sehen.
Ich habe ja schonmal erzählt, was ich Anfang der 90er in Le Bourget erlebt habe, da waren die Stände von Perm und CFM nebeneinander, und Perm hat solz das P90 präsentiert, bei dem nur noch Sprit dosiert wurde um alles zu regeln, den Rest mchte das Triebwerk dank ausgefuchster 3D Aerodynamik komplett selbst, während nebenann CFM stolz die neueste Fadec Generation des CFM präsentierte, die ganz autark Dutztende von Atuatoren und Ventilen quer durchs ganze Triebwerk steuerte und je nach Betriebszustand Schaufeln verstellte, Luft abblies, Gehäusetemperaturen regelte. Da kommt man schon ins Grübeln ob das Optimum nicht irgendwo zwischen den zwei Extremen liegen muss...
Hoffe nicht, die sind mit ihren Triebwerken seit den 1930er nicht weitergekommen.

Für mich ist da eher 1942 der Benchmark. Da gibt es ja den legendären Forschungsbericht aus der Flugerprobungsstelle Rechlin, der schon haargenau beschreibt was bei Jettriebwerken so möglich ist (inclusive der Erkenntnis, dass für Bomber und deren Reichweite Zweikreistriebwerke notwendig sind, und für welche Einsatzzwecke welche Bypassverhältnisse optimal sind, und dass man für Jäger mit Nachbrenner nochmal eine deutliche Aufwertung erreichen kann...).
Nur die dort ebenfalls beschriebenen Kolbentriebwerke die einen ummantelten hochdrehenden Fan antreiben und deren Abwärme an die komprimierte Sekundärluft abgegeben wird bevor die in der Düse wieder austritt sind nie realisiert worden... Ansonsten beschreibt der Bericht was in den 60ern Stand der Technik wurde.
Mit dem heute ganz großen Unterschied, dass Turbineneintrittstemperaturen von 900°C als das mit den verfügbaren Materialien maximal machbare angesehen wurden, was die maximal mögliche Verdichtung begrenzt, und wir da schon lange sehr viel weiter sind. Da kommen 2000 °C so langsam in Reichweite, da geht vielleicht noch was.
Kleine Korrektur, es ist sogar von Ende 1941...